Klavierkonzert C-Dur op.15
Das erste von Beethoven 1800 als op.15 veröffentlichte Klavierkonzert, ist nicht das erste von Beethoven komponierte Konzert. Wie sein zweites Klavierkonzert in Bb-Dur datiert seine Entstehung aber weit in seine frühern Jahre als jugendlicher Komponist zurück. Es enthällt noch viel vom dem gelöst spielerischen Duktus des 18. Jahrhunderts.
- 18. Jahrhundert
- 19. Jahrhundert
- 20. Jahrhundert
- mit Originalkadenz Vers.1
- mit Originalkadenz Vers.2
- mit Originalkadenz Vers.3
- Kadenz: Carl Czerny op.200
- Kadenz: Carl Czerny op.315
- Kadenz: Ignaz Moscheles
Golden Age
Feat. DJ Traxx
Golden Age
Feat. DJ Traxx
Golden Age
Feat. DJ Traxx
Golden Age
Feat. DJ Traxx
Golden Age
Feat. DJ Traxx
Golden Age
Feat. DJ Traxx
- Kadenz: Beethoven I
- Kadenz: Beethoven II
- Kadenz: Beethoven III
- Kadenz: F.Hensel 1805-1847
- Kadenz: C.Reinecke 1824-1910
- Kadenz: A.Rubinstein 1829-1894
- Kadenz: C.Saint-Saens 1835-1921
Golden Age
Feat. DJ Traxx
Golden Age
Feat. DJ Traxx
Golden Age
Feat. DJ Traxx
Golden Age
Feat. DJ Traxx
Golden Age
Feat. DJ Traxx
Golden Age
Feat. DJ Traxx
Golden Age
Feat. DJ Traxx
- mit Kadenz: Beethoven I
- mit Kadenz: Beethoven II
- mit Kadenz: Beethoven III
- Kadenz Vers.III - Variante F.Busoni 1966-1924
- Kadenz: H.Schwartz 1861-1924
- Kadenz: Edwin Fischer 1886-1960
- Kadenz: Erwin Schulhoff 1894-1942
Golden Age
Feat. DJ Traxx
Golden Age
Feat. DJ Traxx
Golden Age
Feat. DJ Traxx
Golden Age
Feat. DJ Traxx
Golden Age
Feat. DJ Traxx
Golden Age
Feat. DJ Traxx
Golden Age
Feat. DJ Traxx
Selected tab:
mehr Informationen zu diesen Beethovenaufnahmen 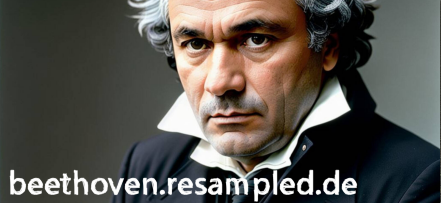
Die Kadenz von E.Fischer wird gestreamed von pianostreet.com